Startseite www.archiv-grundeinkommen.de
Text aus:
Zeitschrift
für Sozialökonomie Nr. 133 vom Juni 2002
Seite 14 -
19
ISSN
0721-0752
Helmut
Creutz:
Vollgeld und
Grundeinkommen
Anmerkungen
zum Buch "Vollgeld" von Joseph Huber
Es ist schon
erstaunlich: Da ist seit 1998 ein umfangreiches und inhaltsschweres Buch über
das Geld auf dem Markt, das im Umfeld der Geldreformbewegung (vielleicht auch
wegen seiner hohen Kosten?) bislang kaum Beachtung gefunden hat. Dabei gibt
dieses von Joseph Huber geschriebene Buch "Vollgeld" (1) mit dem
Untertitel "Beschäftigung, Grundsicherung und weniger Staatsquote durch
eine modernisierte Geldordnung" gleich einen doppelten Anlass, sich mit
ihm zu befassen. Einmal weil sich das Buch auf detaillierte und erfreulich
realitätsnahe Weise mit unserem heutigen Geldwesen beschäftigt – zum zweiten,
weil sich Huber in einem separaten 20seitigen Anhang mit den
Geldreformvorstellungen von Silvio Gesell auseinandersetzt.
Dieser Anhang
mit dem Titel "Kritik des Schwundgeldes nach Silvio Gesell" (der
leider nicht dem sonstigen Niveau des Buches entspricht), bedarf sicherlich
einer gründlichen Aufarbeitung und Stellungnahme, die hoffentlich noch
geleistet wird. An dieser Stelle soll lediglich auf die wichtigsten
Reformvorschläge Hubers eingegangen werden, die in seinem Buch unter den
Begriffen "Vollgeld" und "Bezugsrechtfinanzierte
Grundeinkommen" behandelt werden.
Trotz meiner
z.T. kritischen Anmerkungen zu diesen Schwerpunkten und trotz Hubers
fragwürdiger Behandlung des Themas Gesell und Freiwirtschaft enthält das Buch
die aus meiner Sicht gründlichste Analyse unseres heutigen Geldsystems, die in
den letzten Jahrzehnten von einem Wissenschaftler geleistet worden ist. Das vor
allem im Hinblick auf seine weitgehend sachgerechten Darlegungen der
Geldmengendefinitionen sowie der Beziehungen zwischen Notenbanken und den
Geschäftsbanken. Darüber hinaus enthält es höchst interessante und detaillierte
Abhandlungen und Reformanregungen zu fast allen anderen
gesellschaftspolitischen Bereichen. Auch wenn der Preis des Buches mit fast
fünfzig Euro sicher für viele eine zu hohe Schwelle bleiben wird, ist diese
Ausgabe sinnvoll und allen an Geldfragen eingehender Interessierten zu
empfehlen.
"Vollgeld"
Unter diesem
Begriff versteht Huber im wesentlichen die Umwandlung der heutigen bei den
Banken geführten Giral- bzw. Buchgeldbestände in offizielles Geld, also eine
Ausweitung der staatlich herausgegebenen gesetzlichen Zahlungsmittel, die ja
auch von mir seit längerem als sinnvoll angesehen wird (2). Vergleichen kann
man diese Übernahme des Giralgeldes durch die Notenbanken mit jener der
Banknoten im 19. Jahrhundert.
Bekanntlich
hatten Banken und Geldverleiher bereits seit dem Mittelalter für die Hinterlegung
von Münzgeld an ihre Kunden Quittungen herausgegeben, die zunehmend selbst
Zahlungsmittelfunktionen übernahmen. Schließlich haben die Kreditinstitute für
diesen Zweck sogar spezielle "Banknoten" gedruckt, die aus
praktischen Gründen die Münzbenutzungen immer mehr zurückgehen ließen, vor
allem für Zahlungsabwicklungen bei größeren Beträgen. Da mit der Zunahme dieser
Ersatzzahlungsmittel die Notenbanken Ende des 19. Jahrhunderts ihre Kontrolle
über die Geldmittel gefährdet sahen, haben sie die Ausgabe dieser Banknoten
nach und nach selbst übernommen und schließlich den Geschäftsbanken untersagt.
Ähnlich wie
einst bei der Herausgabe der Banknoten haben die Banken in der Vergangenheit
auch eine andere zahlungstechnische Innovation weiter ausgebaut, nämlich die
Einrichtung spezieller Konten, mit deren Hilfe die Bankkunden ihre
Zahlungsvorgänge unbar abwickeln können. Statt also Bargeld für Zahlungen
abzuheben und zum Empfänger zu expedieren, der es dann häufig wieder einzahlen
musste, konnte man mit einem entsprechend aufgefüllten Girokonto diesen
Zahlungsausgleich durch direkte Übertragung von Konto zu Konto durch die Bank
erledigen lassen. Verständlich, dass dieser praktische Zahlungsweg zunehmend
genutzt wurde und inzwischen umsatz- und umschlagsmäßig die Barzahlungen fast
überall weit überflügelt hat. Mit dieser Nutzungsausweitung ist diesen
Bankkonten inzwischen - ähnlich wie vorher bei den Banknoten - immer mehr die
Zahlungsmitteleigenschaft zugekommen. Deshalb sollen - nach Huber - auch diese
Bestände auf den Girokonten in die Verantwortung der Notenbanken übernommen und
damit zu vollwertigem Geld - eben "Vollgeld" - werden!
Mit der
Verwirklichung dieses Vorschlags würde nicht nur die Kontrolle der gesamten
Zahlungsmittel in die Hände der Notenbanken gelegt, sondern endlich auch eine
klare Trennung zwischen Geld und Guthaben geschaffen, die heute bei den
Sichtguthaben nicht gegeben ist. Mit einer solchen Übernahme durch die
Notenbanken würden außerdem die ganzen strittigen Geldmengendefinitionen mit all
ihren fragwürdigen Varianten überflüssig. Ebenfalls käme es zu einer klaren
Abgrenzung zwischen den Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Geschäfts- und
der Notenbanken, womit auch die heutigen Spekulationen und Streitereien über
die "Geldschöpfung der Banken" endgültig überwunden werden könnten.
Geld ist dann unstrittig nur noch das, was die Notenbank als Münz-, Papier- und
Buchgeld in ihrer Obhut hat und den Bürgern zur Verfügung stellt.
Diese
eigentlich längst überfällige und auch in meinem Buch geforderte klare Trennung
zwischen Geld und Guthaben bzw. Geld und Kredit (3) wäre also mit vielen
Vorteilen verbunden - nicht zuletzt mit einer Stärkung der Position der
Notenbanken, die heute aufgrund der Ausweitung der Sichtguthabenbestände und
des Rückgangs der Bargeldnutzung die direkte Kontrolle über die
Zahlungsmittelmenge immer mehr verlieren. Denn während sich die Bar- und
Giralgeldbestände in den ersten drei bis vier Nachkriegsjahrzehnten noch
relativ im Gleichschritt mit der nominellen Wirtschaftsleistung entwickelt und
lediglich gegeneinander verschoben haben, hat ihre Zunahme inzwischen diese
Grenzen gesprengt (siehe Darstellung 1). Diese Überentwicklungen, die nicht
zuletzt auch mit den gewachsenen Spekulationsmassen und -kassen zusammenhängen
dürften, machen es den Notenbanken immer schwerer, mit Hilfe des relativ
kleiner werdenden Hebels in ihren Händen das Geschehen im Geldbereich noch
korrekt zu steuern.
Darstellung
1:
Entwicklung
monetärer Größen im Vergleich
Deutschland
1950 bis 2000 - im Fünfjahresabstand in % des BSP
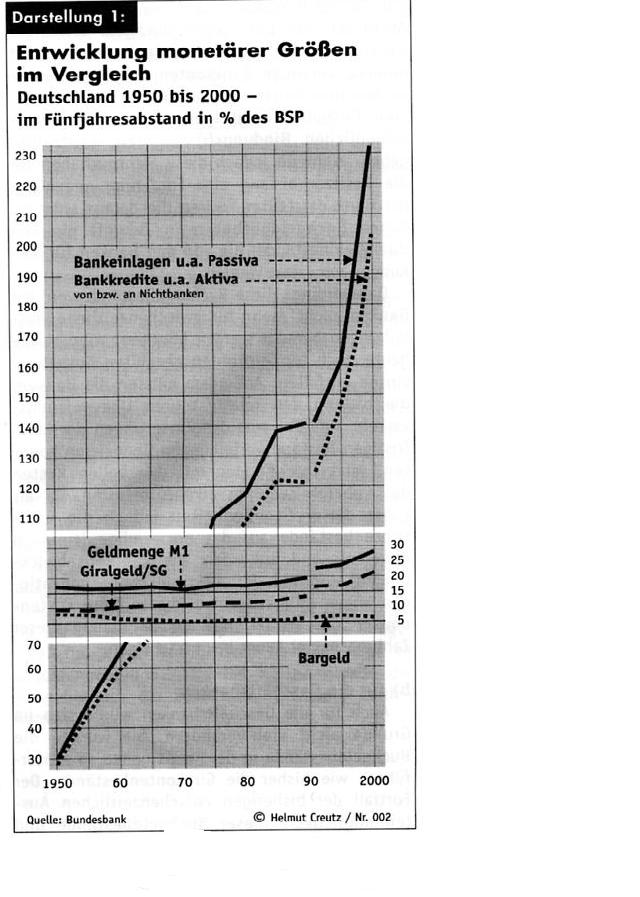
Die
Auswirkungen von "Vollgeld"
a) für die
Bankkunden
Für die
Bankkunden bleibt im Grunde alles beim alten. Die Bestände auf den
Buchgeldkonten sind – wie bisher auf den Giralgeldkonten – ihr frei verfügbares
Eigentum. Weiterhin von den Banken geführt, können die Besitzer über diese
Konten wie bisher ihre Überweisungen, Daueraufträge usw. abwickeln. Das gleiche
gilt für die Bargeldein- und -auszahlungen, den Austausch von Bar- gegen
Buchgeld sowie die Übertragung überschüssiger Geldhaltungen auf normale
verzinste Bankkonten usw. Auch würde es bei den Banken weiterhin die
verschiedensten Guthaben- und Kreditformen mit unterschiedlichen
Bindungsfristen bzw. Laufzeiten geben. Während jedoch diese Sichtguthaben für
die Besitzer bislang eine Forderung gegenüber der Bank darstellten, wären die
daraus entstandenen Buchgeldguthaben in Zukunft ein Teil ihrer Geldbestände,
die von den Banken für ihre Kunden verwaltet werden.
Da
allerdings diese Buchgeldbestände von den Banken nicht mehr für
zwischenzeitliche Ausleihungen benutzt werden könnten, würden alle heute noch
für Girokonten gezahlten Guthabenzinsen entfallen. Außerdem müssen die Banken,
die bislang den relativ teuren Überweisungsverkehr zum Teil aus den
Zinserträgen der kurzfristigen Bestandsverleihungen finanzieren konnten, jetzt
ihre Kunden mit den vollen Kosten des unbaren Zahlungsverkehrs belasten. Da als
Folge dieser Gegebenheiten jedoch die Geldkontenbestände auf das notwendige
Minimum abgebaut und außerdem die Zahlungsabwicklungen aufgrund der
elektronischen Innovationen immer billiger werden, dürfte diese Kostenumlage
die Attraktivität der Benutzung dieser Zahlungsmittel kaum beeinträchtigen.
b) für die
Geschäftsbanken
Auch für die
Geschäftsbanken würde sich im Grunde nicht viel verändern. Sie würden die
Buchgeldbestände in der Praxis genau so weiterführen wie bisher die
Girokontenbestände. Der Fortfall der bisherigen zwischenzeitlichen
Ausleihmöglichkeit dieser Buchgeldbestände und die damit verbundenen
Zinseinnahmeverluste sind für das Kreditgeschäft jedoch nicht ohne Folgen.
Allerdings ist anzunehmen, dass die Banken ihren Kunden sehr rasch täglich
kündbare und verzinste Geldmarktkonten für ihre überschüssigen liquiden
Geldbestände anbieten werden. Damit können die Bankkunden nicht nur den Kosten
der Geldhaltung kurzfristig entgehen, sondern die Banken können auch die sonst
entstehenden Kreditlücken weitgehend schließen. Da alle Überweisungen jedoch
nicht mehr von Zentralbankgeld begleitet zu werden brauchen, ergeben sich für
die Banken andererseits aber auch Vereinfachungen. Das gilt auch für den
Wegfall der Mindestreserve-Vorschriften. Infolgedessen können die Banken – wie
bei dem Bargeld in den Kassen – auch über die Höhe ihrer
Zentralbankgeldguthaben selbst bestimmen.
Was für die
Banken ein größeres Problem sein könnte: die Kosten für die insgesamt zu
verwaltenden Geldbestände, die ja um die heutigen Girokonten erweitert werden,
wären höher. Würden diese erweiterten Geldbestände, wie bisher beim Bargeld
üblich, den Geschäftsbanken von den Notenbanken über zinsbelastete Kredite zur
Verfügung gestellt, würden die Belastungen für die Banken und damit die
Wirtschaft deutlich ansteigen. Zur Schaffung eines weichen Übergangs sollen
darum nach dem Vorschlag von Huber die Buchgeldbestände den Banken anfangs
zinsfrei überlassen und nach und nach in normale Notenbankkredite umgewandelt
werden – sicher eine etwas fragwürdige Lösung dieses Problems.
In diesem
Zusammenhang stellt sich allerdings die grundsätzliche Frage, ob und weshalb
eigentlich diese Kreditkosten – sowohl für die Bargeldversorgung als dann auch
für die Buchgeldversorgung – bei den Banken hängen bleiben sollen, die sie
ihrerseits letztlich nur auf die Kreditnehmer überwälzen können, die meist gar
kein Bargeld in Anspruch nehmen. Eine nach dem Verursacherprinzip sachgerecht
kalkulierte Umlage der Kosten auf die Geldnutzer ist also in unserem Geldsystem
längst überfällig. Entweder muss den Banken das eigentlich selbstverständliche
Recht zur Kostenumlage auf diese Bar- und Buchgeldnutzer eingeräumt oder ein
anderer Weg der Geldausgabe gewählt werden, der die Banken nicht mit Kosten
belastet.
Mit einer
Umlage der Bankkosten auf die Geldnutzer ergäbe sich außerdem – sofern sie auf
die Bestände und nicht auf die Vorgänge bezogen werden – die Möglichkeit zu
einer Verstetigung der Geldhaltung bzw. des Geldumlaufs, was für die
Notenbanken von großem Vorteil bei der Steuerung der Geldmenge wäre und im
Prinzip der Forderung nach einer zinsunabhängigen Geldumlaufsicherung entsprechen
würde.
c) für die
Notenbanken
Neben dem
bereits angeführten größeren Einfluss auf die Geldmenge und deren Steuerung und
Kontrolle würde sich das Geldvolumen in den Händen der Notenbanken erheblich
vergrößern. Geht man von den heutigen Gegebenheiten aus, würde die ausgegebene
bzw. zu verwaltende Gesamtgeldmenge, bezogen auf den Währungsraum der Deutschen
Bundesbank und das Jahr 2000 zum Beispiel von rund 330 Mrd DM (Bargeld einschl.
Kassen- und Zentralbankgeldbestand der Banken) durch den hinzukommenden
Buchgeldbestand auf ca 1.150 Mrd DM ansteigen. Da es sich dabei jedoch
Lediglich um Buchungsvorgänge handelt, ist diese Ausweitung der Geldmenge – im
Gegensatz zu jenen im Bargeldbereich – nur mit einem geringem Arbeits- und
Kostenaufwand verbunden. Außerdem würde sich mit dem Wegfall der
Mindestreserven für die Notenbanken der Kontrollaufwand verringern.
Soweit die
erweiterten Geldmengen über Kredite an die Geschäftsbanken ausgegeben werden,
würden natürlich die Zinseinnahmen der Notenbanken erheblich zunehmen. Da diese
Einnahmen jedoch – soweit sie die Kosten der Notenbanken übersteigen – an den
Staat und damit an die Bürger zurückfließen, würde es sich dabei letztlich um
eine Art Steuer mit sozial eher positiven Umverteilungswirkungen handeln.
Diese Frage
nach den Verteilungswirkungen stellt sich natürlich auch bei allen laufenden
Ausweitungen der Geldmenge, die ja mit der Wirtschaftsleistung zunehmen muss.
Mit diesem Komplex der Notenbankeinnahmen bzw. Geldmengenausweitungen verknüpft
Huber nun das Modell einer allgemeinen Grundsicherung bzw. von
Grundbezugsrechten, die direkt und ohne Umweg über den Staat den Bürgern zugute
kommen sollen.
Grundsicherung
– Grundbezugsrechte
Das Thema
einer Grundsicherung der Bürger aus Steuermitteln wird bereits seit den 1960er
Jahren immer wieder diskutiert, vor allem auch in den USA, wie Huber in seinem
Buch belegt. Unter den Begriffen Bürgergeld, Grundeinkommen oder Negativsteuer
ist diese öffentliche Zuwendung in den letzten Jahren auch bei uns immer
häufiger ins Gespräch gekommen. Verstanden wird darunter bekanntlich ein
bestimmtes Einkommen, das entweder an alle Bürger oder – wie von Huber
entwickelt – statt anderer sozialer Hilfen an bestimmte Bürgergruppen gezahlt
werden soll.
Statt der
heute üblichen Finanzierung solcher sozialen Ausgleichszahlungen über Steuern
und Abgaben verknüpft Huber diese nun mit den Geldmengenausweitungen der
Notenbanken. Dabei kommt ihm die Übernahme der heutigen Sichtguthaben durch die
Notenbanken sehr entgegen, da sich damit das zur Verfügung stehende
Verteilungspotenzial erheblich vergrößert. Denn während beispielsweise die
Bargeldausweitungen der Bundesbank im Schnitt der letzten zehn Jahre bei 9 Mrd
DM lagen, nahmen die Sichtguthaben p.a. um 43 Mrd DM zu. Das heißt, im
vergangenen Jahrzehnt hätte im rechnerischen Mittel jährlich ein Gesamtbetrag
von 52 Mrd DM als Verteilungsmasse zur Verfügung gestanden.
Vergleicht
man diese Beträge mit den Sozialausgaben des Staates, dann schmelzen sie
allerdings auf eine relativ geringe Größe zusammen. So lag beispielsweise das
gesamte Sozialbudget 1999 bei 1.300 Mrd DM. Mit dem Zuwachs der Geldmenge um 52
Mrd DM hätten gerade die Ausgaben für die Sozialhilfe finanziert werden können.
Bedenken
gegen eine Verknüpfung von Geldmengensteuerung und sozialer Grundsicherung
Hier ist als
erstes die Frage zu stellen, ob eine Verknüpfung bzw. Vermischung der Aufgaben
einer Notenbank mit sozialstaatlichen Aufgaben überhaupt sinnvoll bzw.
vertretbar ist. Weiterhin dürfte es mehr als problematisch sein, weitgehend
festliegende und gleichbleibende Ausgabenposten des Staates an eine äußerst
schwankende Größe wie die jährlichen Geldmengenausweitungen zu binden. So nahm
– um einige Beispiele anzuführen – die Bargeldmenge 1997 überhaupt nicht zu.
1998 nahm sie sogar um 5 Mrd DM ab. 1999 stieg sie dann wieder um 13 Mrd DM, um
im Jahr 2000 erneut um 10 Mrd abzunehmen. Das heißt, in den letzten vier Jahren
gab es per saldo insgesamt sogar eine leichte Abnahme der Bargeldmenge. Für
eine Verteilung hätte also überhaupt kein Geld zur Verfügung gestanden.
Diese
Tatsache ist Joseph Huber natürlich bekannt und für ihn sicherlich auch einer
der Gründe gewesen, die stärker zunehmenden Giralgeldbestände mit in die
offizielle Geldmenge aufzunehmen. Denn beide Bestände zusammen haben z.B. in
den letzten vier Jahren von 917 auf 1.123 Mrd DM – also um 206 Mrd DM –
zugenommen. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 55
Mrd DM. Allerdings schwankten die jährlichen Zunahmen ganz erheblich zwischen
21 und 85 Mrd DM.
Vergleicht
man diese Beträge mit den oben angeführten Gesamtausgaben im Sozialbereich,
wird deutlich, dass sie auch nach einer Zusammenfassung von Bar- und Giralgeld
nicht zur Finanzierung der Sozialausgaben ausreichen. Außerdem ist noch zu
beachten, dass der relativ hohe Anstieg von M1 in den letzten Jahren wesentlich
mit dem Börsenboom und den damit verbundenen Ausweitungen der
Spekulationskassen zusammengehangen haben dürfte. Die Spekulationsgelder werden
ja weitgehend im Bereich der heutigen Sichtguthaben gehalten. Langfristig
gesehen würde sich die Geldmenge M1 – wie von 1950 bis 1988 der Fall – bei
korrekter Geldmengensteuerung jedoch nur im Gleichschritt mit der
Wirtschaftsleistung entwickeln, womit der Verteilungsspielraum durch das
hinzukommende Notenbankgeld auch nur im Gleichschritt mit dem
Wirtschaftswachstum zunehmen würde. Danach hätte z.B. in den letzten vier
Jahren der jährliche Zuwachs nur bei 25 Mrd DM gelegen, pro Kopf der
Bevölkerung also bei 300 DM im Jahr. Beachtet man weiterhin, dass in den
verschiedenen Plänen für ein Bürgergeld bzw. eine Steuerrückerstattung heute
Größenordnungen von 1.000 DM pro Kopf und Monat im Gespräch sind (was mit einem
Gesamtbetrag von rund 980 Mrd pro Jahr den heutigen Aufwendungen für den
sozialen Sektor nahe käme), wäre die mögliche Finanzierungshilfe der Notenbank
mit monatlich 25 DM eher eine Bagatelle.
Geht man
zudem noch davon aus, dass es in einer nachhaltigen bzw. einer optimalen
ökologisch orientierten Kreislaufwirtschaft eines Wachstums der Wirtschaft und
damit auch der Geldmenge gar nicht mehr bedarf, würde es gar keine
Möglichkeiten mehr geben, seitens der Notenbank irgendwelche öffentlichen
Ausgabenfelder zu finanzieren. Außerdem ist zu befürchten, dass bei einer
solchen Übernahme der Finanzierung staatlicher Ausgaben durch die Notenbank der
politische Druck auf diese noch mehr als heute zunehmen würde, eine lockere
Geldpolitik zu betreiben. Ganz besonders in Flautezeiten, in denen die
Sozialkosten des Staates steigen, während sowohl die Steuereinnahmen als auch
die Geldmengenausweitungen tendenziell zurückgehen.
Weiterhin
ist die Frage zu stellen, ob die Notenbanken unter den heutigen Gegebenheiten
überhaupt auf die Ausgabe des Neugeldes über Kredite an die Geschäftsbanken
verzichten können. Selbst Joseph Huber ist der Auffassung, dass dieser Weg auch
zukünftig kaum auszuschließen ist. Denn so lange die Notenbanken die Geldmenge
nicht direkt über den Preisindex steuern können, das heißt, so lange sie den
Geldumlauf nicht in den Griff bekommen, werden sie gezwungen sein, den
Geldbedarf weiterhin über ständig revolvierende Ausleihungen des
Notenbankgeldes zu kontrollieren, auch um damit über die Zinsentwicklung und
deren Beeinflussung den Bedarf der Märkte abzutasten. Eine kreditfreie Ausgabe
des Neugeldes vorbei an den Banken – ob an den Staat oder direkt an die Bürger
– würde aus diesen Gründen erst möglich werden, wenn der Geldumlauf auf andere
Weise verstetigt und damit zu einer berechenbaren Größe wird. Diesen Weg
schließt Huber jedoch mit seiner Kritik an den Lösungsvorschlägen Gesells
leider von vorn herein aus.
Fazit
Auch wenn
nach kürzlichen Untersuchungen die Endnachfrage in Deutschland 1997 noch zu 76
Prozent über Bargeldzahlungen abgewickelt wurde (siehe Darstellung 2), dürfte
auf Grund der zunehmenden bargeldlosen Zahlungsalternativen die Frage einer
Einbeziehung des Giralgeldes in die Verantwortung der Notenbanken immer
dringlicher werden. So erfreulich darum Hubers Plädoyer für diese Einbeziehung
ist, so fragwürdig scheint mir jedoch die Verknüpfung der Geldemission mit
staatlichen Zahlungsverpflichtungen zu sein. Dies vor allem, wenn diese
Geldemission, zur Verstetigung der Kaufkraft des Geldes, zukünftig noch enger
als bisher an die Leistungsentwicklung angeglichen werden muss.
Anmerkungen
(1) Joseph
Huber, Vollgeld — Beschäftigung, Grundsicherung und weniger Staatsquote durch
eine modernisierte Geldordnung. Berlin: Duncker & Humblot, 1998.
(2) Helmut
Creutz, Das Geldsyndrom — Wege zu einer krisenfreien Wirtschaftsordnung.
München: Econ, 5. Taschenbuchaufl. 2001.
(3) Helmut
Creutz, Geldschöpfung durch Geschäftsbanken - Theorie oder Wirklichkeit?, in:
Zeitschrift für Sozialökonomie 108. Folge (1996), S. 22-41.
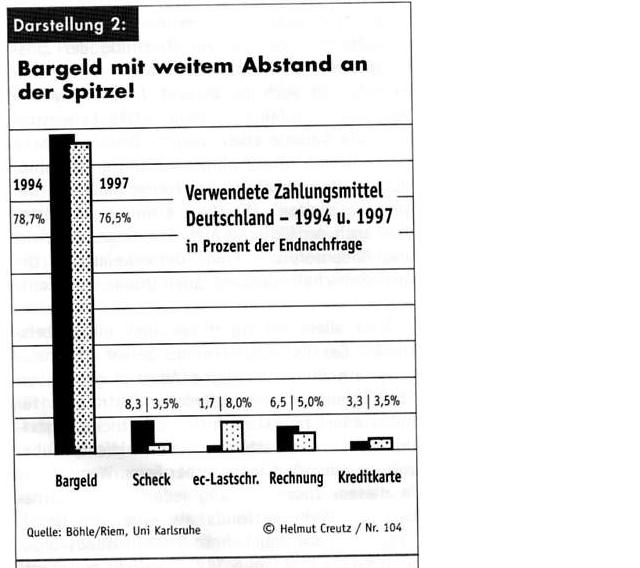
Darstellung
2:
Bargeld mit
weitem Abstand an der Spitze!
Das Bargeld
ist in Deutschland immer noch das weitaus beliebteste Zahlungsmittel. Bedenkt
man, dass Mitte der 80er Jahre das Endnachfragevolumen noch zu 83 Prozent mit
Bargeld abgewickelt wurde, ist auch der längerfristige Rückgang auf rund 78,7
bzw. 76,5 Prozent in den 90er Jahren nicht allzu groß.
Wie die
Zahlen in der Grafik wiedergeben, bewegen sich die vier größten Konkurrenten
des Bargeldes im Einzelhandel auch heute noch alle unter zehn Prozent des
Umsatzvolumens. Außerdem spielten sich die größten Verschiebungen zwischen 1994
und 1997 innerhalb dieser Alternativen ab. So ist z.B. die Scheckbenutzung von
1994 bis 1997 von 8,3 auf 3,5 Prozent gefallen, während die Benutzung des
ec-Lastschriftverfahrens von 1,7 auf 8,0 Prozent förmlich explodierte. Aufgrund
der praktischen Handhabung dieser ec-Karten, die mit Bargeldspeicherung auch
als Geldkarten benutzbar sind, ist eine weitere rasche Zunahme ihrer Verwendung
zu vermuten. Allerdings dürfte sie zu einem guten Teil zuerst einmal andere
unbare Zahlungsmittel verdrängen, vor allem wahrscheinlich die für den Handel
besonders teuren Kreditkarten. Auch wenn diese Kreditkarten in den USA, bezogen
auf die Transaktionswerte, den Markt dominieren, ist das Bargeld – was sicher
überraschend ist – auch dort noch mit 87 Prozent an den Transaktionsvorgängen
beteiligt. Gemessen an diesen Transaktionsvorgängen dürfte die Bargeldnutzung
im deutschen Einzelhandel also hoch im Bereich der 90er Prozentgrößen liegen.